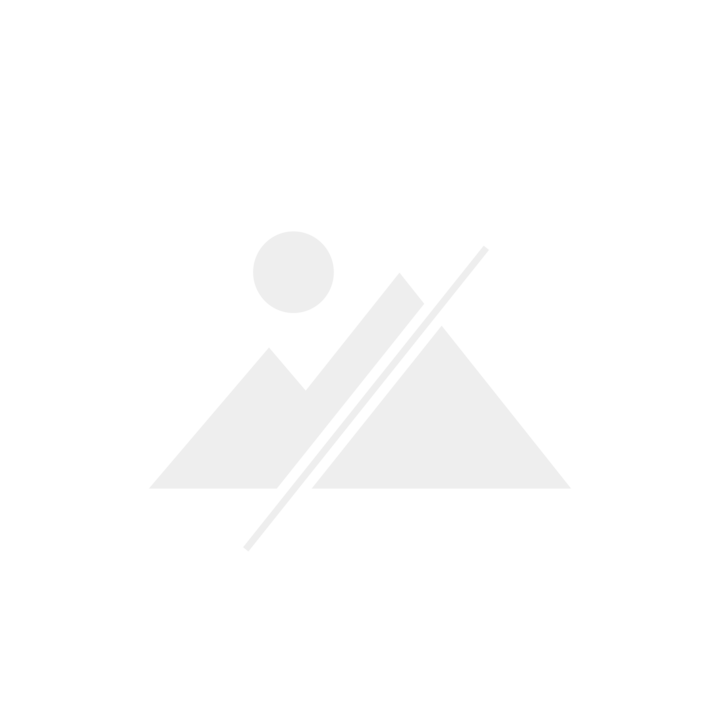

«The Hunter: Call of the Wild»: Wir spielen einen Jagdsimulator mit einem echten Jäger
«The Hunter: Call of the Wild» ist ein Jagdsimulator. Damit ich mir nicht aus Versehen in den Fuss schiesse und den ganzen Wald aufscheuche, habe ich mir professionelle Hilfe geholt: Einen Jäger. Er wird uns auch erklären, wie viel das Spiel mit der Jagd im echten Leben gemein hat.
Eigentlich heisst es, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mir geht es anders. Ich seh vor lauter Bäumen das Reh nicht. Oder wars ein Hirsch? Ich kenn mich schon mit dem hiesigen Wildbestand nicht aus, wie will ich mich da in einem deutschen Wildreservat zurechtfinden? Darum steht mir auch Andreas Ernst zur Seite, lieber Dres genannt. Er ist ein richtiger Jäger. Nicht von Beruf, aber aus Leidenschaft. Sein Revier ist das Berner Oberland, wo er meist Gämsen und Rothirsche jagt.
Heute bleibt sein Gewehr aber im Schrank. Stattdessen hilft er mir einen Hirsch zu erlegen. Einen Damhirsch genauer gesagt. Dank den entsprechenden Tooltips des Spiels habe ich das mittlerweile klarstellen können. Wir sind nämlich in keinem echten Wald und ich hab auch keine echte Flinte über die Grenze geschmuggelt. Nein, wir befinden uns im fiktiven Hirschfelden im PC-Spiel «The Hunter: Call of the Wild». Ein Jagdsimulator, der es sich auf den Jagdhut geschrieben hat, das beste Jagderlebnis aller Zeiten zu liefern. Sollte das zutreffen, müssen sich die Waldbewohner heute keine Sorgen machen. Ich treff im echten Leben im 300-Meter-Stand knapp die Scheibe und die bewegt sich nicht mal. Wie wird das wohl in der virtuellen Welt?

Während ich die Steuerung übernehme, schaut mir Dres gespannt über die Schulter. Obwohl wir mangels eines anständigen Gamer-Laptops nur mit mittleren Details spielen können, staunt Dres über die Grafik: «Hier gefällts mir. Dichter Wald, Blumenwiesen, die im Wind hin und her wippen und eine herrliche Geräuschkulisse aus zwitschernden Vögeln und raschelnden Bäumen.» Ich muss ihm zustimmen. Das Wildreservat hat Entwickler Avalanche wirklich perfekt eingefangen. Mit maximalen Details kommt die Natur voll zur Geltung. Dafür braucht ihr aber auch einen ordentlichen PC.
Kein Spiel für Abzugsfreudige

Da ich das Spiel bereits angespielt habe, erkläre ich Dres kurz die Grundzüge. Im Prinzip geht es darum, möglichst viele Tiere zu erlegen. Jeder erfolgreiche Abschuss wird gewertet und mit Erfahrungspunkten belohnt. Dabei zählt auch das richtige Vorgehen und wo man das Tier getroffen hat. «Perfekt ist ein Blattschuss, also durchs Herz», klärt mich der Jäger auf. «Wieso nicht auf den Kopf?, frag ich. «Das wäre ja auch tödlich.» «Das ist unethisch. So was ist unter Jägern verpönt», meint Dres entschieden. Ich entscheide mich, ihm nicht zu erzählen, wie meine erste virtuelle Jagd endete. Als Videospielveteran ziele ich halt immer auf den Kopf. Weil «Boom! Headshot!» hat sich in meinem Kopf eingebrannt.

Das Spiel ist bemüht, möglichst realistisch zu sein und zeigt nach dem Abschuss exakt auf, wo man das Tier getroffen hat. Und genau wie der Experte es erklärt hat, erzielt ein Schuss durchs Herz am meisten Punkte. So weit sind wir aber noch nicht. Wir schleichen immer noch im Tempo einer Weinbergschnecke durch den dichten Wald. In jedem anderen Spiel würde ich längst auf die Shift-Taste hämmern, um zu rennen. Weil ich mich aber nicht jetzt schon lächerlich machen will, bewege ich mich im Schritttempo, um das Wild nicht aufzuschrecken – wo auch immer es sich verstecken mag. Gesehen haben wir nämlich ausser ein paar Hasen und Vögeln noch nichts. «Meinst du, ich bin zu laut?», frag ich Dres. Hauptsächlich um etwas Kommunikation zu machen. «Viel zu laut. Würdest du wirklich Hirsche jagen, würden die dich längst hören.» Ich bin eben doch immer noch zu ungeduldig. Bereits im Normaltempo könnt ihr eure Beute verscheuchen je nach dem auf welchem Untergrund ihr euch bewegt. Das laute Knacken, wenn ihr direkt durch einen Busch geht, statt drum herum, kann reichen, dass das Wild Warnrufe von sich gibt. Das hilft mir wenigstens, die Tiere zu Orten.

Neben Spuren, die ihr am Boden entdeckt und die euch eine ungefähre Richtungsangabe geben, vernehmt ihr auch die Rufe des Beutetiers. Mal sind das Brunftschreie, mal Warnrufe. Als wir zum wiederholten Male einen Rotfuchs bellen hören, meint Dres allerdings, dass das niemals so oft vorkommen würde. Irgendwo muss das Spiel eben Kompromisse machen zwischen Realismus und Spielspass. Sonst würden wir noch stundenlang ziellos im Wald herumirren.
Geduld ist eine Tugend – und langweilig
Ich komme mir vor wie Winnetou, während ich verzweifelt der nicht enden wollenden Spur unseres Damhirsches folge. Ob das in Echt auch so sei, frag ich Dres. «Überhaupt nicht. Es kann schon sein, dass man mal Spuren findet, aber so gut wie im Spiel erkennt man die nie». Im Schnee oder Lehm sei das noch möglich, aber nicht wie hier im Wald oder auf Wiesen. Stattdessen verlässt man sich bei der Jagd hauptsächlich aufs Auge. Man unterscheidet zudem zwischen Pirschen und Ansitzen. Ansitzen beschreibt das Jagen vom Hoch- oder Bodensitz aus, bei dem man mit viel Überblick auf seine Beute wartet – idealerweise mit etwas Zielwasser, denk ich mir. Das käme mir jetzt auch gelegen.

Pirschen ist hingegen das, was man in «The Hunter: Call of the Wild» primär macht: schleichen und aktiv sein Ziel suchen. Allerdings sei das so wie hier eher unrealistisch. Man hätte sich längst einen guten Spot gesucht, von wo aus man auf sein Ziel lauern kann. «Man wandert nicht ständig durchs Unterholz.» Komme hinzu, dass ich dafür die falsche Waffe trage. Ich blicke fragend auf meine mit Zielfernrohr bestückte Flinte. «Wenn du so wie in diesem Spiel herumschleichst, brauchst du eine Schrotflinte. Oder eine Kombinationswaffe. Damit kannst du schnell reagieren, falls plötzlich ein Reh aus dem Gebüsch springt.» Im Übrigen bezeichne eine Flinte immer ein Schrotgewehr. In meinen virtuellen Händen trage ich aber eine Büchse, wie mich Dres später informierte. Da ich mich bereits zu fest an dieses Umgangswort gewöhnt habe und wir noch keine andere Waffe freigeschaltet haben, gehts weiter wie gehabt.
Da ist was im Busch

Nach 45 Minuten in Echtzeit, erblicke ich plötzlich rund 50 Meter vor mir einen ahnungslosen Hirsch. Der Wind kommt von vorne, so dass mich das Tier nicht riechen sollte. Hirsche haben ein sehr empfindliches Riechorgan und sehen extrem gut, erklärt mir Dres. Deshalb schleiche ich mich ganz langsam an das Tier heran. Der Hirsch hat uns noch nicht bemerkt, obwohl ich wie ein Depp aufrecht mitten im Wald stehe. Aber wenn ich mich hinlege, sehe ich nichts ausser Gestrüpp.
Als mir der Hirsch sein Hinterteil zuwendet, will ich losballern, aus Angst ihn nach der unendlich langen Pirschjagd wieder aus den Augen zu verlieren. «Soll ich schiessen?», frag ich vorsichtshalber. «Auf keinen Fall. Das gibt eine Riesensauerei», meint Dres. «Ah, wegen dem Darm?», entfährt es mir, als ich das dicke Hinterteil anstarre. «Nein, wegen dem Magen», sagt Dres. Der sei voller Gras und das verteile sich dann überall. Ich bezweifle, dass ich das Tier werde ausnehmen müssen, warte aber zur Sicherheit.
Als sich das Tier langsam zur Seite dreht, zieh ich den Abzug. Kein Blut spritzt wie man es aus anderen Spielen kennt, aber das Tier hat aufgebockt. Ich scheine es getroffen zu haben. Allerdings bleibt das Tier nicht stehen, sondern macht sich mit einem Satz aus dem Staub. Schnell renne ich zur Abschussstelle und finde Blutspuren, denen wir folgen. «Es ist nicht unüblich, dass ein getroffenes Tier noch 10 oder 20 Meter weiter rennt. Selbst bis zu 100 Meter können vorkommen», sagt Dres.
Kurz darauf finden wir das Tier wie es wild im Kreis rennt. Ein sehr ungewöhnliches Verhalten, findet Dres. Ich schreibe es einem Fehler im Spielcode zu. Aus dem Stand gebe ich dem Tier den Gnadenschuss. Selbst aus dieser kurzen Distanz findet Dres, dass das mit dieser Waffe unrealistisch gewesen sei. «Aus dem Stand schiessen, besonders mit dem Kugelgewehr ist wie Lotto spielen. Die Gefahr ist auch zu gross, dass man das Tier verletzt». Mindestens anlehnen müsse man das Gewehr, im Fachjargon anstreichen genannt. Vielleicht steckt in mir einfach ein besserer Schütze als gedacht.

Die Auswertung des Abschusses zeigt in dreidimensionaler Röntgensicht, wo meine beiden Kugeln getroffen haben. Die erste hat die Schulter getroffen und die zweite traf die Brustwirbelsäule – also direkt in den Rücken. Nicht schlecht für den ersten Versuch.
Auf ein Neues
Wir wollen es nochmal wissen und gehen erneut auf Pirschjagd. Als wir auf ein weites Feld kommen, findet Dres, ich solle mich hier mal still hinlegen und den Waldrand beobachten. Könne ja sein, dass plötzlich ein Tier auftaucht. Ich mache wie geheissen, bleibe aber skeptisch. Der Gamer in mir ist überzeugt, dass das Spiel die aktive Jagd fordert und dass wir Spuren nachlaufen müssten. Und als ich den Ruf eines Hirsches vernehme, stehe ich bereits wieder auf den Beinen. Plötzlich schlägt das Wetter um und es beginnt wie aus Eimern zu Giessen. Das sieht nicht nur beeindruckend aus, schlechtes Wetter sei auch für die Jagd von Vorteil, werde ich aufgeklärt. Es verschleiert die Bewegungen. «Bei diesem Regen hätte ich mir allerdings längst einen Unterstand gesucht und etwas zu knabbern ausgepackt», meint Dres. Da unser virtueller Jäger immun gegen nasse Kleider und Erkältungen ist, marschieren wir stattdessen munter vorwärts.

Als das Wetter wieder auftut, nehme ich am gegenüberliegenden Waldrand eine Bewegung wahr. Auf Dres’ Hinweis lege ich mich hin und robbe so weit nach vorne, bis mir das Gras nicht mehr die Sicht versperrt. Dabei bemerke ich, dass ich im Kreis gelaufen bin und mich wieder auf dem gleichen Feld befinde, wo Dres mir geraten hat, einfach mal liegen zu bleiben. Jäger 1, Gamer 0.
Von der Distanz her, sei unsere Position optimal, findet Dres. Schätzungsweise 150 Meter liegen zwischen mir und meinem Ziel. Wenn ich aber durch das Zielfernrohr schaue, ist das Tier viel zu klein für einen sicheren Treffer. «Normalerweise gibt es verschiedene Vergrösserungen bei solchen Gewehren», belehrt mich Dres. Und siehe da, eine Bewegung am Mausrädchen und schon ist der Hirsch doppelt so gross. Hätte ich eigentlich auch früher draufkommen können. Ich ziele auf die Brust, halte den Atem an und drücke ab. Wie beim letzten Mal springt das Tier sofort davon. Kurz danach finden wir es nur wenige Meter neben der Abschussstelle. Der Rapport zeigt, dass ich es am Hals erwischt habe. Kein schlechter Treffer, meint Dres. Damit machen wir Feierabend und ziehen Bilanz.
Fazit

Wie realistisch ist denn nun «The Hunter: Call of the Wild»?
«Man merkt, dass es ein Spiel ist», so Dres. Man würde nie so durch den Wald schleichen und wenn doch, bräuchte man eine andere Waffe. «Der Stutzen ist das läze Gewehr», sagt er im breiten Oberländer Dialekt. Und meint damit das Jagdgewehr. Bei der echten Jagd lege man sich meistens auf die Lauer und wartet, bis das Tier zu einem kommt.
Auch hätte ich wohl nie was getroffen, wenn alle reellen Faktoren miteinbezogen würden. So können bereits ein paar Äste oder Blätter den Schuss beeinflussen. Und ohne Anlehnen geht auch nichts. Ein echter Jäger merkt diesen Unterschied. Auf der anderen Seite findet Dres, dass es für ein Spiel zu wenig Action bietet: «Wir sind extrem viel rumgelaufen, ohne etwas zu entdecken. Es müsste viel mehr Tiere geben». Dafür hat ihm die detaillierte Spielwelt sehr gut gefallen und er könnte es sich durchaus vorstellen, so ein Spiel zu spielen. Da er in seinem Daheim, einem Berner Holzhaus, aber weder Internet noch einen Computer hat, wird das schwierig.
«The Hunter: Call of the Wild» hat eindeutig Züge eines realistischen Jagdsimulators. Macht aber einige Kompromisse zu Gunsten des Spielspasses. Niemand will schliesslich einen ganzen Tag vor dem PC verbringen, ohne auch nur einmal ein Tier vor die Flinte zu bekommen. Was Laut Dres nicht selten vorkommt. Jagen ist eine Gedulds- und Erfahrungssache. Primär ersteres braucht ihr in diesem Spiel. Denn nur wenn ihr im Schneckentempo herumschleicht, habt ihr Chancen auf Erfolg. So ist «The Hunter: Call of the Wild» hauptsächlich ein Geduldsspiel – aber ein richtig schönes.
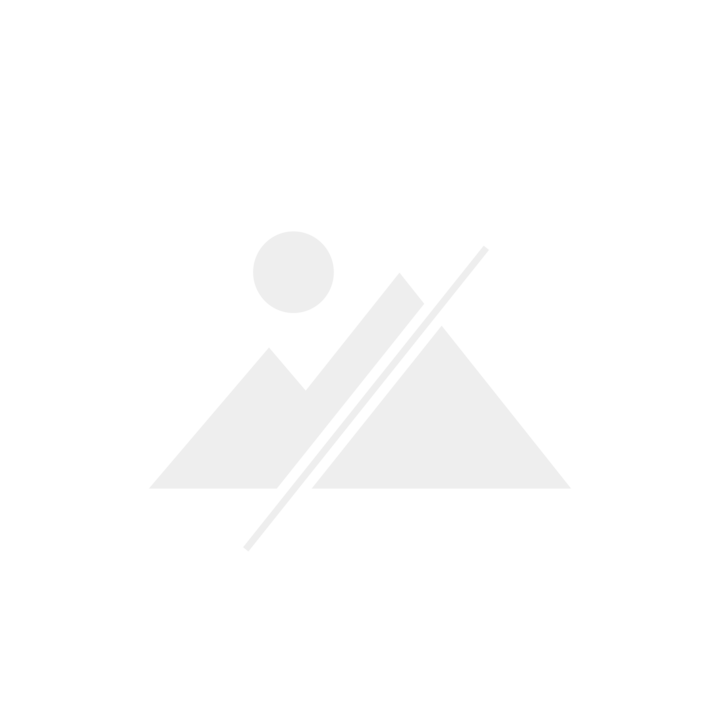
Das könnte dich auch interessieren
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.

